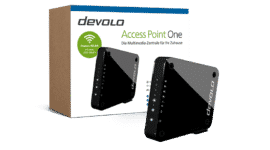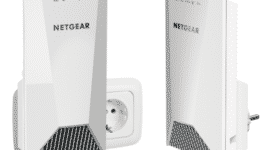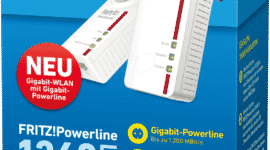Kontroverse Frequenzpolitik: Digitale Zukunft Deutschlands auf dem Prüfstand
Die Bundesregierung hat eine weitreichende Entscheidung in der Frequenzpolitik getroffen, die bei Experten und Branchenverbänden für erhebliche Kontroversen sorgt. Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) plant, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, das gesamte obere 6-GHz-Frequenzband vorrangig dem Mobilfunk zuzuweisen. Die WLAN-Branche und Glasfaseranbieter sprechen von einer „fatalen Fehleinschätzung“ mit weitreichenden Folgen für Deutschlands digitale Infrastruktur.
Worum geht es konkret?
Das 6-GHz-Frequenzband ist in zwei Bereiche unterteilt:
Unteres Band (5.945 – 6.425 MHz):
- Bereits für WLAN (Wi-Fi 6E) in der EU freigegeben
- Bietet 480 MHz zusätzliches Spektrum für drahtlose Netzwerke
- Wird bereits aktiv genutzt
Oberes Band (6.425 – 7.125 MHz):
- Derzeit noch für bestehende Anwendungen reserviert (Richtfunk, Satellitendienste)
- Umfasst 700 MHz wertvolles Frequenzspektrum
- Streitpunkt der aktuellen Debatte
Gerade das obere Band gilt als entscheidend für die Zukunft der drahtlosen Kommunikation. Es bietet die Kapazität für höhere Datenraten, ist aber aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften vor allem für kurze Reichweiten geeignet.
Position der Bundesregierung
Laut einem Sprecher des BMDS wird der Frequenzbedarf der Mobilfunknetzbetreiber im oberen 6-GHz-Band höher eingeschätzt als der von WLAN-Nutzern. Die Begründung: Mit Blick auf künftige 6G-Anwendungen sei eine Priorisierung des Mobilfunks die „sachgerechteste Lösung“. Das Ministerium betont, dass es sich für eine „effiziente Nutzung“ des oberen 6-GHz-Frequenzbandes einsetze und der Schutz bestehender Dienste selbstverständlich beachtet werde.
Die Entscheidung kommt nicht aus dem Nichts. Bereits in den vergangenen Jahren haben Mobilfunkbetreiber wie die Deutsche Telekom und Vodafone erste Tests im 6-GHz-Bereich durchgeführt. Vodafone meldete beispielsweise bereits Übertragungsgeschwindigkeiten von 5 Gbit/s.
Scharfe Kritik aus der Branche
Die Reaktionen auf die Pläne der Bundesregierung sind deutlich. Lisia Mix-Bieber, Leiterin Bundes- und Europapolitik beim Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO), spricht von einer „herben Enttäuschung für den Digitalstandort Europa“.
Hauptkritikpunkte:
- Kurzfristig kein Nutzen: Eine Reservierung der Frequenzen für Mobilfunkkonzerne bringe zunächst gar keinen praktischen Mehrwert für Verbraucher. 6G-Netze werden frühestens Ende des Jahrzehnts kommerziell verfügbar sein.
- Begrenzte Reichweite: Die hohen Frequenzen um 6 GHz haben eine sehr geringe Reichweite und schlechte Gebäudedurchdringung. Selbst langfristig könne der 5G- und 6G-Funkbetrieb in diesem Spektrum die Netzabdeckung in Ballungsräumen allenfalls marginal verbessern.
- Glasfaserausbau behindert: Die in Deutschland mit hohem Aufwand errichteten Glasfasernetze könnten ihre volle Leistungsfähigkeit nicht entfalten, wenn das Spektrum für WLAN fehlt. Die „letzte Meile“ zum Endgerät würde zur digitalen Sackgasse.
- Kostenfreier Zugang gefährdet: WLAN ermöglicht kostenfreien Internetzugang für alle Bürger. Eine exklusive Vergabe an Mobilfunkbetreiber würde diesen demokratischen Zugang einschränken.
Technische Hintergründe
Wi-Fi 7 – die verpasste Chance?
Der neueste WLAN-Standard Wi-Fi 7 kann theoretisch Datenraten von bis zu 46 Gigabit pro Sekunde erreichen – allerdings nur mit ausreichend breiten Kanälen. Ohne das obere 6-GHz-Band bleiben diese Möglichkeiten stark eingeschränkt. Wi-Fi 7 setzt auf Kanäle von bis zu 320 MHz Breite. Im derzeit verfügbaren unteren 6-GHz-Band ist jedoch nur Platz für maximal einen solchen Kanal.
6G – die Herausforderung der Physik
Für den künftigen 6G-Standard gilt: Je höher die Frequenz, desto geringer die Reichweite. Die 6-GHz-Frequenzen:
- Durchdringen Wände schlecht
- Haben eine Reichweite von nur wenigen hundert Metern
- Eignen sich hauptsächlich für dicht besiedelte Ballungsräume
- Benötigen ein extrem dichtes Netz aus „Small Cells“ (Mikrozellen)
Die Mobilfunkanbieter müssten für eine effektive Abdeckung Tausende zusätzliche kleine Sendestationen installieren – in Laternen, an Gebäuden, auf Werbetafeln. Die Umsetzung wäre technisch aufwendig und teuer.
Europäische Dimension
Am 12. November 2025 sollte die Radio Spectrum Policy Group (RSPG) der EU-Kommission ihre Empfehlung zur langfristigen Nutzung des oberen 6-GHz-Bandes vorlegen. Diese Empfehlung dient der Kommission als Grundlage für die Festlegung verbindlicher Nutzungsbedingungen, die dann in allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden.
Die RSPG hatte bereits in einem 56-seitigen Entwurf vier mögliche Optionen für eine Aufteilung des Bandes zwischen Mobilfunk und WLAN vorgestellt. Eine klare Präferenz besteht für eine Segmentierungslösung – also eine Aufteilung des Spektrums.
Internationale Vergleiche
Die globale Landschaft zeigt unterschiedliche Ansätze:
- USA: Das gesamte 6-GHz-Band (1.200 MHz) ist für unlizenzierte Systeme (WLAN) freigegeben
- China: Hat sich für eine Lizenzierung für 5G und 6G entschieden
- Indien: Plant, das untere Band für WLAN zu öffnen, das obere für Telekommunikationsanbieter zu reservieren
Interessenskonflikte und Lobbyarbeit
Die Debatte um das 6-GHz-Band ist auch eine Lobbyschlacht. Auf der einen Seite stehen zwölf große europäische Telekommunikationsunternehmen – darunter Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica, BT und Orange –, die geschlossen für eine vollständige Zuteilung an den Mobilfunk plädieren. Ihr Argument: Europas Wettbewerbsfähigkeit im globalen 6G-Rennen hänge von zusammenhängendem Mittelband-Spektrum ab.
Auf der anderen Seite formiert sich Widerstand aus der Breitband- und WLAN-Branche:
- Deutsche Glasfaser
- NetCologne
- AVM (Fritz!Box-Hersteller)
- LANCOM Systems
- HPE (Hewlett Packard Enterprise)
- EWE TEL
Diese Unternehmen und Verbände fordern, mindestens 320 MHz des oberen 6-GHz-Bandes für lizenzfreie WLAN-Nutzung freizuhalten.
Ein weiterer Aspekt der Kritik: Der neue Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) arbeitete vor seiner politischen Karriere unter anderem für die Mobilfunkanbieter T-Mobile und Vodafone. Die Linken-Abgeordnete Donata Vogtschmidt äußerte die Vermutung, dass „die Kontakte Herrn Wildbergers in die Mobilfunkbranche sich als hervorragend bezeichnen lassen“ dürften.
Volkswirtschaftliche Perspektive
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die Debatte auch eine Frage der Effizienz:
Pro WLAN:
- Kostenfreier Zugang für alle Nutzer
- Optimale Nutzung bereits verlegter Glasfasernetze
- Kein zusätzlicher Infrastrukturausbau für „Small Cells“ nötig
- Sofort verfügbare Technologie (Wi-Fi 7)
Pro Mobilfunk:
- Vorbereitung auf 6G (ab ca. 2030)
- Mobilität der Nutzer gewährleistet
- Einnahmen für den Staat durch Frequenzauktionen
- Mögliche Verbesserung in Ballungsräumen
Der BREKO argumentiert, dass die Mobilfunker bereits über umfangreiches, noch nicht vollständig genutztes Spektrum verfügen. So sei beispielsweise das n78-Band (3,6 GHz) erst auf etwa 5 Prozent der Fläche Deutschlands ausgebaut.
Der soziale Aspekt
Ein oft übersehener Punkt in der Debatte ist die soziale Dimension. WLAN über Glasfaseranschlüsse ist in der Regel deutlich günstiger als mobile Datentarife. Laut Bundesnetzagentur wird der Löwenanteil des Datenverkehrs über Festnetzanschlüsse und WLAN abgewickelt – nicht über Mobilfunknetze.
Vogtschmidt warnt: „Anstatt das obere 6-GHz-Frequenzband für WLAN zu sichern, setzt sich die Bundesregierung in der EU für eine zumindest teilweise Nutzung dieser Frequenzen auch für Mobilfunk ein. Das ist nicht nur technisch gesehen unsinnig, sondern es birgt sozialen Sprengstoff.“
Besonders betroffen wären:
- Bildungseinrichtungen (Schulen, Universitäten)
- Gesundheitswesen
- Öffentliche Einrichtungen
- Haushalte mit begrenztem Budget
All diese Bereiche profitieren besonders von leistungsfähigem, kostenfreiem WLAN.
Mögliche Kompromisse
Es ist noch nicht endgültig entschieden. Verschiedene Kompromisslösungen sind denkbar:
- Bandaufteilung: Ein Teil des Spektrums für WLAN, ein Teil für Mobilfunk
- Zeitliche Staffelung: WLAN-Nutzung kurzfristig, spätere Migration zu Mobilfunk
- Koexistenz-Modelle: Gemeinsame Nutzung mit technischen Mechanismen zur Interferenzvermeidung
- Regionale Differenzierung: WLAN in ländlichen Gebieten, Mobilfunk in Städten
Der BREKO fordert konkret, mindestens 320 MHz im oberen 6-GHz-Band für die lizenzfreie WLAN-Nutzung freizuhalten. Dies würde zumindest einen Teil der geplanten Wi-Fi-7-Kapazitäten ermöglichen.
Interessanterweise zeigt eine neuere Stellungnahme der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage, dass man sich mittlerweile „für eine effiziente gemeinsame Nutzung des oberen 6-GHz-Frequenzbandes durch WLAN und Mobilfunk sowie durch die bestehenden Dienste“ einsetzt. Dies deutet auf eine mögliche Kompromisslösung hin.
Ausblick und offene Fragen
Die Entscheidung der RSPG am 12. November 2025 wird richtungsweisend sein – aber nicht das letzte Wort. Die finale Regelung wird voraussichtlich auf der Weltfunkkonferenz 2027 getroffen, wo eine globale Koordinierung erfolgen soll.
Zentrale Fragen bleiben offen:
- Wie stark gewichtet die EU-Kommission die unterschiedlichen Argumente?
- Werden technische Lösungen für eine Koexistenz von WLAN und Mobilfunk ausgereift genug sein?
- Wie viel Spektrum wird tatsächlich für einen effizienten 6G-Betrieb benötigt?
- Welche volkswirtschaftlichen Kosten entstehen durch den massiven Ausbau von „Small Cells“?
- Wie entwickelt sich der internationale Wettbewerb und die Standardisierung?
Fazit
Die Auseinandersetzung um das obere 6-GHz-Frequenzband ist mehr als ein technischer Streit zwischen Mobilfunk und WLAN. Es geht um grundsätzliche Fragen der digitalen Infrastruktur:
- Soll Breitbandzugang primär über kostenfreies WLAN oder kommerzielle Mobilfunknetze erfolgen?
- Wie nutzt Deutschland die bereits massiv ausgebauten Glasfasernetze optimal?
- Welche Technologie bietet kurzfristig den größten Nutzen für Verbraucher?
Die Entscheidung der Bundesregierung, dem Mobilfunk Priorität einzuräumen, steht im Kontext einer langfristigen 6G-Strategie. Kritiker werfen jedoch vor, dass diese Weichenstellung die falschen Prioritäten setzt – zulasten eines schnell verfügbaren, kostengünstigen und leistungsfähigen WLANs für alle.
Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Deutschland mit seiner Position auf europäischer Ebene erfolgreich ist oder ob eine ausgewogenere Lösung gefunden wird, die beiden Technologien ausreichend Raum gibt. Eines ist sicher: Die Entscheidung wird die digitale Landschaft Europas für das kommende Jahrzehnt prägen.
Stand: November 2025
Weiterführende Informationen
- Radio Spectrum Policy Group (RSPG): Offizielle EU-Beratungsgruppe für Frequenzpolitik
- BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation: Interessenvertretung der Glasfaser- und Breitbandanbieter
- Wi-Fi Alliance: Internationale Organisation zur Zertifizierung von WLAN-Standards
- Bundesnetzagentur: Deutsche Regulierungsbehörde für Telekommunikation